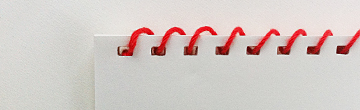Panels / Workshops
Panel 1: Qualitative Forschungsmethoden in der sozial-ökologischen Transformation
Prof. Dr. Christine Bauhardt, Dr. Meike Brückner, M.A. Suse Brettin
Tag 1: Montag, 29.9.2025, 13:30 – 17:00
Tag 2: Dienstag, 30.09.2025, 09:00 – 12:30
Tag 3: Mittwoch, 1.10.2025, 09:30 – 13:00
Abstract
In diesem Panel möchten wir die Aufmerksamkeit auf qualitative Methoden und qualitatives Forschen zur Wissensproduktion um die sozial-ökologischen Transformation aus einer Genderperspektive mit einem Schwerpunkt auf Care richten. Im Kontext der sozialen und ökologischen Krisenverhältnisse erscheint dies dringend geboten, denn es muss handlungsrelevantes Wissen bereitgestellt werden, welches gleichermaßen auf subjektive Lebenswelten und Alltagspraxen sowie auf strukturelle Bedingungen und systemische Hemmnisse fokussiert.
Die Wahrnehmung, Konstruktion und das Wissen über ein Thema werden maßgeblich auch darüber bestimmt, welche Methoden und Perspektiven in der Forschung angewandt werden. Dies zeigt sich nicht zuletzt im Kontext der sozial-ökologischen Krise: Hier setzen vor allem abstrakte Berechnungen und mathematische Modellierungen den Maßstab, um den Stand und die Entwicklung der sozial-ökologischen Krise und mögliche zukünftige Szenarien quantitativ darzustellen.
Qualitative Methoden hingegen ermöglichen die alltäglichen Konsequenzen, Materialisierungen und Wirkmächtigkeiten der sozial-ökologischen Krise aufzuzeigen und dabei einen stärker lebensweltlichen Bezug herzustellen. Darüber hinaus ermöglichen sie eine präzisere Analyse der Rolle von intersektionalen Ordnungs- und Machtkategorien in diesem Kontext.
Aufbau des Panels
Einführend werden wir einen Ein- und Überblick zu qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung geben und fragen, wie Gender als Analysekategorie eingesetzt und erhoben werden kann (Tag 1). Anschließend werden unterschiedliche Methoden vorgestellt und diskutiert sowie deren Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten erörtert. Den Schwerpunkt bilden dabei interaktiv-partizipative Ansätze, die explizit auf den Gegenstand der sozial-ökologischen Transformation fokussieren und im Bereich der Ernährung verortet sind (Photo-Voice, Mahlzeitenkartographien und ‚Cook-along‘ Interviews) (Tag 2). Die in Tag 1 und 2 vermittelten Grundlagen möchten wir nutzen, um an Tag 3 an den Projekten der Teilnehmer*innen zu arbeiten und – sofern gewünscht – Feedback zu geben.
Bewerbung
Kurze Projektbeschreibung (max. 1 Seite) mit folgenden inhaltlichen Punkten:
- Thema
- Erkenntnisinteresse und Fragestellungen
- Stand des Projektes
- Methodenwahl im Projekt bzw. wenn noch nicht definiert, welche Ideen es für die methodische Umsetzung gibt
- Erfahrungen mit Methoden (so vorhanden)
Literatur
- Attride-Stirling, Jennifer (2001): Thematic networks: an analytical tool for qualitative research. Qualitative Research 1(3), 385-405.
- Brückner, Meike (2023): Meal cartographies: Using visual methods to explore geographies of food provisioning and care work. Feministisches Geo-RundMail Nr. 93.
- Degele, Nina (2004): Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Panel 2: Biographieforschung und Oral History in der Geschlechterforschung unter Berücksichtigung bildungstheoretischer und -geschichtlicher Perspektiven
Prof. Dr. Jeannette Windheuser, Dr. Katharina Lux
Teil 1: Montag, 29.9.2025, 13:30 – 17:00
Teil 2: Dienstag, 30.09.2025, 09:00 – 12:30
Teil 3: Mittwoch, 1.10.2025, 09:30 – 13:00
Astract
Während der Etablierung der Frauen- und Geschlechterforschung ab den 1970er Jahren spielte die Geschlechtergeschichte eine wesentliche Rolle. Insbesondere ging es auch um die Bildungsgeschichte von Frauen und ihren Eintritt in sorgende Berufe. Dabei wurde nicht nur die allgemeine Geschichtsschreibung verändert, sondern es kam darüber hinaus zur (Weiter-)Entwicklung bestehender und neuer Forschungsmethoden und ihnen zugrundliegender erkenntnistheoretischer Perspektiven. Für die feministische Forschung ist der Blick auf das Subjekt hinsichtlich zweier Aspekte relevant: Erstens werden mittels der Untersuchung von bspw. Ego-Dokumenten und Oral-History-Zugängen bisher wissenschaftlich marginalisierte gesellschaftliche Erfahrungen überhaupt zu relevanten Forschungsgegenständen. Zweitens reflektiert die feministische Forschung das Subjekt-Objekt-Verhältnis methodisch und theoretisch.
Vor diesem Hintergrund verbindet der Workshop aus interdisziplinärer und teildisziplinärer Perspektive Geschlechterforschung und Erziehungswissenschaft.
Zu Beginn werden in die theoretischen und methodischen Grundlagen von feministischer Oral-History- und Biographieforschung eingeführt. Danach werden spezifische Verfahren der Oral History und der Biographieforschung vorgestellt, um die kollektive Betrachtung von entsprechenden Materialien vorzubereiten. Von den Workshop-Leiterinnen wird eine Auswahl an Datenmaterial bereitgestellt, es ist aber auch möglich eigenes Material einzubringen. Dieses sollte in Form von Oral-History- oder biographischen Interview-Transkripten oder als historisches Dokument mit subjektivem Erfahrungs- oder Biographiebezug vorliegen. Die Workshopleiterinnen bringen durch ihren erziehungs- und bildungstheoretischen Hintergrund insbesondere Kenntnisse zu den Themen Subjektbildung, Generationenverhältnis und zur Bildungsgeschichte ein.
Der Workshop richtet sich sowohl an Interessierte, die sich zum ersten Mal mit den genannten Zugängen befassen möchten, als auch an Personen, die entsprechende Erhebungen durchgeführt haben und ihr Material gerne kollektiv diskutieren möchten und ebenso an Personen, die weitere historische Quellen unter den Gesichtspunkten von subjektiver gesellschaftlicher Erfahrung und Biographie untersuchen möchten.
Zusätzliche Informationen
- 3 Tage, je 3,5 Stunden
- Sprache: deutsch
- für alle Qualifikationsstufen
- Material wird zur Verfügung gestellt, kann aber auch von den TN kommen (s.u.)
Bewerbung
kurze Projektskizze (max. 1 Seite), die beinhaltet:
- Thema
- Erkenntnisinteresse/Fragestellung
- Stand des Projekts
- Stand der Erfahrung mit Zugang und Methode der Oral-History und/oder Biographieforschung
Es besteht die Möglichkeit, eigenes Material einzureichen (Beschreibung max. 3 Sätze). Der konkrete exemplarische Materialeinsatz im WS wird durch die Referentinnen ausgewählt.
Panel 3: Queer und Trans Studies/Readings – Theorie und Praxis im Dialog
Dr. Janin Afken, Prof. Dr. Martina Bengert, Dipl. theol. Yannik Ehmer M.A.,
Liesa Hellmann M.A., Jasper J. Verlinden M.A.
Tag 1: Montag, 29.9.2025, 13:30 – 17:00: Queer Studies – Queer Readings
Tag 2: Dienstag, 30.09.2025, 09:00 – 12:30: Trans Studies – Trans Readings
Tag 3: Mittwoch, 1.10.2025, 09:30 – 13:00: Queer/Trans Poetics
Abstract
Dieses Panel untersucht die Schnittstellen und Unterschiede zwischen Queer und Trans Studies aus theoretischer und methodologischer Perspektive. An Tag 1 und 2 sollen zunächst theoretische Prämissen und Spezifika der Queer und Trans Studies/Readings herausgearbeitet und diskutiert werden. Am dritten Tag werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Trans und Queer Studies in der Lektüre mit Blick auf Trans und Queer Poetics konturiert.
Tag 1 widmet sich dem Queer Reading, einem Spektrum an heteronormativitätskritischen literaturwissenschaftlichen Ansätzen, Texte zu lesen und zu analysieren. Ausgehend von den Strukturen, die auf der Textoberfläche zu beobachten sind, etwa Handlungsebenen, Motive und Figuren, identifiziert und analysiert es Formen des Begehrens und des Geschlechts, die sich der Norm entziehen. Ein weiterer Schwerpunkt queerer Lektüren liegt auf der Analyse und Dekonstruktion von cis-Heteronormativität in literarischen Texten. Der Workshop führt in Methoden des Queer Reading ein und diskutiert unter anderem folgende Fragestellungen: Kann jeder Text queer gelesen werden? Welche Erkenntnisse können mit einem Queer Reading gewonnen werden? Was sind textuelle Ansatzpunkte für ein Queer Reading? Wie lassen sich queere Lektüren von anderen literaturwissenschaftlichen, insbesondere dekonstruktivistischen Ansätzen abgrenzen? Ziel ist es, die Potenziale und Grenzen solcher Methoden für die Analyse und Interpretation von literarischen Texten herauszuarbeiten.
Tag 2 konzentriert sich auf die Besonderheiten der Trans Studies. Anhand ausgewählter theoretischer Texte seit den 1980er Jahren bis heute wird gefragt, was Trans-Theorie ist oder sein könnte, was ihr Untersuchungsgegenstand ist, welche Methoden und Perspektiven sie umfasst und wie sie sich mit Queer-Theorie überschneidet und von ihr abgrenzt. Fragen der Ethik des Lesens und Analysierens von Texten und verletzlichen Körpern werden im Zentrum unserer Diskussion stehen. Wie gehen wir mit konkreten trans Körperlichkeiten in theoretischen Kontexten um? Kann ‚Trans‘ (mit oder ohne Sternchen) als Oberbegriff für alle nicht-normativen geschlechtlichen Praktiken oder Verkörperungen dienen? Wie könnte ‚Transing‘ als kritische Praxis aussehen? Wie gehen wir ethisch verantwortungsbewusst mit historischem Material um? Welche Potenziale besitzen anachronistische Lesarten, ‚shadow archives‘ (Sekula; Nyong‘o) oder ‚critical fabulations‘ (Hartman)?
An Tag 3 wollen wir das Spannungsfeld zwischen Queer und Trans Reading reflektieren, um sowohl theoretische als auch disziplinäre Grenzziehungen auszuloten. Wann gilt ein Text als trans oder queer? Der Begriff der ‚poetics‘ soll ein Feld von Texten und Textualitäten eröffnen, das sich zwischen sogenannter Theorie und sogenannter Praxis bewegt und in seiner geschichtlichen Situiertheit verortet werden muss. Eine mögliche Autorin hierfür wäre die Chicana-Autorin und Aktivistin Gloria Anzaldúa, deren Texte meist von Performativität geprägt sind, hybrid, polyphon, literarisch-philosophisch-politisch-aktivistisch, queerend und transend verfahren. Texte aus der queeren Zeitschriftenkultur der 1920er Jahre funktionieren hingegen anders und greifen wiederum oft lineare Handlungsstrukturen und stereotype Figurenzeichnungen auf. Das Präfix ‚trans‘ verweist auf Bewegung – durch Zeit, Raum, Genres oder Konventionen. In diesem Sinne reflektieren trans Autor*innen die Formbarkeit des Körpers durch die Formbarkeit der Sprache: sei es durch bewusstes Vermischen von Genres wie in den postmodernen Texten der 1980er und 1990er Jahre (z. B. Stryker, Wilchins, Bornstein) oder durch das Experimentieren mit dem poetischen Potenzial von Sprache, um alternative Formen von Verkörperung und Subjektivität auszudrücken.
Zusätzliche Informationen
- Teilnehmer*innenzahl: maximal 30 Personen
- 3 Tage, je 3,5 Stunden;
- Sprache: Der im Vorfeld zur Verfügung gestellte Reader wird hauptsächlich englischsprachige Texte enthalten. Kommunikationssprachen werden Deutsch und Englisch sein. Wir laden dazu ein, dass die Teilnehmer*innen in der von ihnen präferierten Sprache kommunizieren. Weitere Sprachen können je nach Sprachfähigkeiten der Teilnehmer*innen übersetzt werden.
- für alle Qualifikationsstufen
- Material wird in einem digitalen Reader zur Verfügung gestellt
Bewerbung
Motivationsschreiben (max. 1 Seite, Deutsch oder Englisch) unter Berücksichtigung der folgenden Fragen:
- Welche aktuellen Diskussionen innerhalb der Queer/Trans Studies interessieren Sie? Worin bestehen für Sie offene Fragen?
- Welcher Text/welches Zitat aus dem Bereich der Queer/Trans Studies beschäftigt Sie besonders und warum?
Workshop 1: Re-writing in der Rechtswissenschaft
Chris Ambrosi LL.M.
Dienstag, 30.09.2025, 14:00 – 17:30
Abstract
Recht befindet sich laufend in Bewegung. Das passiert wesentlich über Praxen des Neu- und Umschreibens; etwa über Gesetzgebung oder über Rechtsmobilisierung. Zusehends
greifen akademische und rechtspolitische Kontexte diese Praxis des Neu- und Umschreibens als zielgerichtetes „Re-Writing“ – von Gerichtsentscheidungen oder
Gesetzesentwürfen – auf. Hier setzt der Workshop an. Ausgehend von der internationalen Feminist Judgments Bewegung und dem Berliner Projekt Re:Law erschließen sich die Teilnehmenden methodengeleitete Prozesse des Einschreibens in das Recht und damit zugleich eine interdisziplinäre Kritik und Reflexion von Recht.
Ziel ist, sich am Beispiel einer konkreten Gerichtsentscheidung Barrieren juristischer Eigenlogik zu überwinden und so einen Einblick in vertiefte Auseinandersetzung mit Recht zu eröffnen. Dazu erarbeiten wir uns zum Einstieg relevante Grundlagen des intersektionalen und interdisziplinären Rechtsforschungsstands sowie Methodiken und Techniken eines interdisziplinären Re-Writings im organisatorischen und prozessualen Zusammenhang der im Workshop behandelten Gerichtsentscheidung. Darauf aufbauend entwerfen Kleinteams Re-Writing Designs für ausgesuchte Gerichtsentscheidungen. Dazu stehen ihnen prozessbegleitende Leitfragen zur Verfügung. Die Ergebnisse diskutieren und reflektieren wir in der Großgruppe um gemeinsam Eckpunkte eines kollaborativen und interdisziplinären Arbeitens mit Recht zu skizzieren.
Zusätzliche Informationen
- Der Workshop wird auf deutsch gehalten.
Literatur
- Sußner / Westphal / Mehrens / Baer, 2025, Re:Law, in: Forschungsgruppe Recht-Geschlecht-Kollektivität. Das umkämpfte Allgemeine und das neue Gemeinsame, Verlag Barbara Budrich, im Erscheinen.
- Hodson, Loveday (2018): Collaboration as Feminist Methodology – Experiences from the Feminist International Judgements Project. In: Oñati Socio-legal Series 8 (9), 1224-1240.
- Majury, Diana (2006): Introducing the Women’s Court of Canada). In: Canadian Journal of Women and the Law (18/1), 1-12.
- Munro, Vanessa E. (2021): Feminist Judgements at the Intersection. In: Feminist Legal Studies (29), 251-261.
Workshop 2: Filmische Forschung – Film as research – Künstlerische Forschung und filmbezogene Forschungspraxen
Prof. Dr. Brigitta Kuster
Dienstag, 30.09.2025, 14:00 – 17:30
Abstract
Historisch haben die visuelle Anthropologie oder der Dokumentarfilm als Kunstform, als politisches Instrument, aber auch als Träger und Vehikel von Wissen eine wichtige Rolle gespielt. Und obwohl das archivische, das historische Potenzial von Film schon sehr früh erkannt wurde, haben Historiker:innen Film erst sehr spät als zulässiges Material für ihre Forschungen anerkannt. Die Digitalisierung hat zu einer markanten Veralltäglichung audiovisueller Medien geführt und Film scheint zu einem integralen Bestandteil der Art und Weise geworden zu sein, wie die Menschen des 21. Jahrhunderts ihre Welt verstehen. Mit artistic research wird heute vielfach ein multisensorischer, ‚kreativer‘ und teilweise auch kollaborativer oder partizipativer Zugang zu Forschung verbunden. Auch bei der Verschiebung qualitativer empirischer Forschungsmethoden hin zu verkörperten, praxisbezogenen und erfahrungsbasierten Formen der Untersuchung spielen audiovisuelle Medien nicht selten eine entscheidende Rolle.
Film soll in diesem Workshop aber weder als Mittel zur Visualisierung von Forschungsdaten oder als Quelle, sondern als situierte Forschungspraxis der Geschlechterforschung im Zentrum stehen, wobei er entweder Teil der Forschungsmethode oder auch Grundbestand der Forschungsleistung sein kann. Wir betrachten Film somit nicht nur als Produkt oder Vorgehensweise, sondern im Kern als vielschichtigen Prozess mit unterschiedlichen Arbeitsphasen und in komplexen Überschneidungen zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und ästhetischer Gestaltung.
Zunächst werde ich vor dem Hintergrund eigener Filmforschungsarbeiten (Kuster 2025) einen Input mit Reflexionen darüber geben, inwiefern Film als ästhetische Erkenntnismethode, aber auch als Ausdrucksform gerade an den Rändern etablierter Wissensformen interessant sein kann. Anschließend sollen in einem gemeinsamen Workshop die individuellen Projekte der Teilnehmenden im Zentrum stehen. Zur besseren Vorbereitung des Workshops wird um eine Anmeldung mit einem Projektabstract gebeten, aus dem der jeweilige filmische Zugang deutlich wird. Im Zuge des Workshops sollen methodische Herausforderungen, Hürden und Blockaden, Ideen und Erfahrungen, und auch einschlägige Literatur ausgetauscht werden.
Literatur
- Brigitta Kuster (2025), Territoires – Filmtranskripte, Berlin: Scriptings: Political Scenarios.
Workshop 3: Reflexivity and Positionality in Interdisciplinary Film Research – with a Special Focus on Documentary and Autobiographical Film
Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider
Tuesday, 30.09.2025, 14:00 – 17:30
Abstract
This workshop focuses on questions of (self-)reflexivity and positionality in interdisciplinary film research, with a particular focus on documentary and (family) autobiographical films. It is suitable for advanced MA students and doctoral candidates in their first year, especially if film-related research from an intersectional perspective is going to play a central role in the thesis.
To approach the question of “putting the ‘me’ in method” in film-related research, it is useful to first reflect about the distinction between methodology and method. We will do this together on the basis of a selected film example and thereby also enter into the topic of the workshop.
The second part of the workshop will offer space for an open exchange on specific questions about the participants' current research projects. Interested participants are therefore invited to send in a short abstract of their projects and their questions by email in advance.
Application
- Please send a short abstract of your project and questions by email in advance to: nadja-christina.schneider@hu-berlin.de
- The workshop will be held in English
Recommended Reading
- Alisa Lebow (2012). The Cinema of Me: The Self and Subjectivity in First-Person Documentary Film. Columbia University Press.
- Michael Renov (2004). The Subject of Documentary. University of Minnesota Press.
- Nandini SIkand (2015). Filmed Ethnography or Ethnographic Film? Voice and Positionality in Ethnographic, Documentary, and Feminist Film. Journal of Film and Video 67 (3-4). 42-56.
Workshop 4: Analysis of Scientific Arguments on Sexdiversity as Social Scientific Issues (SSI)
Dr. habil. Sigrid Schmitz
Tuesday, 30.09.2025, 14:00 – 17:30
Abstract
Gender diversity, in terms of roles, identities or desire, is a central starting point for Gender and Queer Studies. In the Natural Sciences (Biology, Medicine, Health Sciences), too, there has been a debate about biological diversity versus binarity with a thematic focus on sexdiversity for some years now. Using the example of scientific publications that position themselves for or against sexdiversity, this workshop will test analytical approaches in order to understand the argumentation structures of Life Sciences’ knowledge production and to be able to assess their effects in social discourse.
Life Science texts derive their power from the presentation of seemingly objective facts from research findings and often appear unassailable at first glance. However, these publications also justify their respective positions with socially situated arguments.
Feminist Science Studies and the perspective on the Natural Sciences as Social Scientific Issues – i.e. always as social-scientific problem areas – offer methodological approaches for analyzing argumentation structures and rhetorics in Life Science publications. They thus enable a critical reflection on the myth of objectivity. With the help of text-analytical guidelines, we will focus on the following questions:
- How can justifications and references in the texts be revealed as expressions of social debates? Which rhetorics can be extracted?
- How are the respective convictions legitimized by the selection and presentation of certain scientific results? Which results are ignored?
- How are values and norms inscribed in scientific argumentation? Where and how are social and cultural references incorporated into the seemingly objective presentation of facts?
On the basis of such an analysis, we will discuss the significance and impact of the sexdiversity debate from Life Science knowledge production for and on social gender discourses.
Further Details
- The workshop will take place in English.
- As we have limited time for the workshop, we will not be able to include presentations from participants.
- No specific requirements for the application.
Recommended Reading
Please note: this list may be updated shortly before the autumn school begins
- Ainsworth, Claire (2015): Sex redefined. Nature 518, 288–291. https://doi.org/10.1038/518288a.
- Rehmann-Sutter, Christoph; Hiort, Olaf; Krämer; Ulrike M.; Malich, Lisa & Spielmann, Malte (2023): Is sex still binary? Medizinische Genetik 35 (3), 173-180. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/medgen-2023-2039/html
- Wright, Colin & Hilton, Emma N. (2020): The Dangerous Denial of Sex. WSJ Open. Feb. 13, 2020. https://www.wsj.com/articles/the-dangerous-denial-of-sex-11581638089.
- Wright, Colin (2021): Sex is not a Spectrum. Reality’s Last Stand. Feb 01, 2021. https://www.realityslaststand.com/p/sex-is-not-a-spectrum.